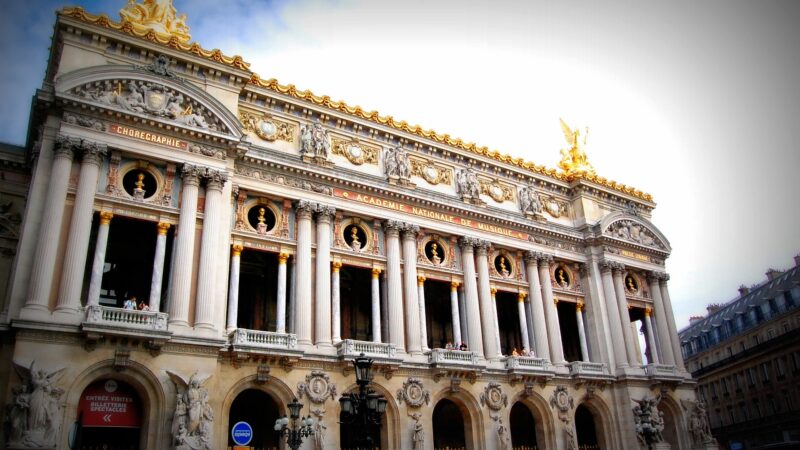Mov:ement: Agnès Varda – eine Ikone des französischen Films

Institutionelles Denken war ihr zuwider: Als Pionierin der französischen Nouvelle Vague war Agnès Varda eine leidenschaftlich unabhängige und rastlos neugierige Visionärin, deren Kunst in der französischen Filmlandschaft eine Ausnahmestellung einnimmt. In der heutigen Kolumne möchte ich einen Blick auf die Regisseurin werfen, die die Regeln des französischen Kinos Ende der 1950er Jahre grundlegend revolutionierte und als eine der Schlüsselfiguren des modernen Films gilt.
von Friederike Hirth
Agnès Varda und ihre Kunst
Varda, geboren 1928 als Tochter einer französischen Mutter und eines griechischen Vaters in Brüssel, verbrachte ihre Kindheit in Belgien, ihre Jugend in Sète und ihre Studienjahre in Paris. Im Alter von 26 Jahren gründete sie ihre eigene Produktionsgesellschaft Cinè Tamaris und drehte mit geringen finanziellen Mitteln ihren ersten Spielfilm »La Pointe Courte«. Der französische Filmregisseur Alain Resnais erkannte die Besonderheit des gedrehten Materials, übernahm gegen ein tägliches kostenloses Abendessen Schnitt und Montage und unterstützte die junge Filmschaffende sogar beim Vertrieb des Filmes. Heute gilt »La Pointe Courte« als erster Beitrag der Nouvelle Vague, jener Welle neuartiger Filme junger Filmschaffenden (u.a. Chabrol, Truffaut und Godard), die zu Beginn der 1960er Jahre – in Abgrenzung zum typischen Erzählkino Hollywoods – den französischen Film revolutionierten. Anfangs blieben die Filme der Regisseurin hinter den Arbeiten ihrer männlichen Kollegen versteckt – doch Varda wusste sich schnell im Umfeld der männerdominierten Aufbruchsbewegung zu behaupten. Fünf Jahre nach ihrem ersten Film hatte sie wieder alle Mittel zusammen für einen Spielfilm: »Cléo – Mittwoch von 5 bis 7« (1961) zeigt nahezu in Echtzeit im Leben einer schönen, verwöhnten Sängerin, die getrieben von der Angst vor dem Ergebnis einer Krebsuntersuchung durch Paris hetzt und ein frühes Beispiel für Vardas feministischen Standpunkt darstellt, der sicher zu ihrer Außenseiterinnenposition im Rahmen des französischen Avantgardefilms beitrug. In den folgenden Jahren wurden ihre Arbeiten explizierter: Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Los Angeles kam sie 1969 mit mehreren politischen Kurzfilmen (u.a. »Black Panthers«, auf den ich später noch genauer eingehen werde) und den Ideen und Motivationen der amerikanischen Frauenrechtsbewegung zurück, die zum Beispiel in ihrem Spielfilm »Die eine singt, die andere nicht« (1976) verarbeitet wurden. Einen großen Publikumserfolg hatte sie erst 1985 mit einer Art weiblichem Roadmovie, »Vogelfrei«, in dem sie sich visionär mit den Themen Freiheit und Ökologie beschäftigt, die auch heute noch von großer Relevanz sind. Nach einem Gesamtwerk von über 40 Spiel- und Dokumentarfilmen hat Varda in den letzten Jahren mit Foto- und Videoinstallationen experimentiert und vielfach Bilanz gezogen: In ihren filmischen Selbstporträts »Die Strände von Agnès« (2008) und »Varda by Agnès« (2019) zeigt sie Landschaften, Menschen und Kunstwerke, die sie geprägt haben und die sie liebt. Und dazwischen sich selbst, eine kleine, bunt gekleidete, quicklebendige Frau von 85 Jahren auf der Suche nach dem, was sie Cinécriture nennt – das Schreiben mit der Kamera. Im März 2019 starb die französische Filmemacherin im Alter von 90 Jahren in Paris.
Agnès Varda bewegt sich in ihren Filmen frei zwischen Genres und Formaten. So realisiert sie feministische Musicals ebenso wie engagierte politische Dokumentarfilme, Essayfilme über Fotografie und bildende Kunst ebenso wie liebevolle Porträts von Menschen, die ihr nahestanden, und bewegende Spielfilme. Ganz egal, in welchem Format oder welchem Medium sie sich ausdrückt: Konstant bleibt ihre unvergleichliche Fähigkeit, aus jeder Konstellation und Situation ein Bild zu machen, eine Komposition, die zugleich eine Einstellung in einem Film ist und eine Bildschöpfung, die auch für sich stehen und als Fotografie an der Wand hängen könnte. In ihren subjektiven Dokumentationen entwickelt sie einen ganz eigenen Tonfall und Blick und ist als Autorin ständig präsent, was allerdings keinesfalls als Zeichen von Narzissmus zu interpretieren ist, sondern einen durch und durch ehrlichen und natürlichen Eindruck macht.
Es ist schwer, Vardas künstlerisches Schaffen in all seinen vielen Facetten aufzugreifen und wiederzugeben. Nichtsdestotrotz möchte ich anhand drei ihrer Filme zeigen, wie vielseitig und breitgefächert ihre Werke waren – sowohl inhaltlich als auch stilistisch – und weshalb sie sich den Titel als Ausnahmeregisseurin mehr als verdient hat.
»Cléo – Mittwoch von 5 bis 7« / »Cléo – de 5 à 7« (1961)

Wie bereits kurz beschrieben folgt Agnès Vardas zweiter Spielfilm seiner Protagonistin Cléo (Corinne Marchand) durch die Straßen von Paris, wo die junge Frau auf eine ärztliche Diagnose wartet, die ihre schwere Krankheit bestätigen soll. Diesen quälend langen Moment der Ungewissheit erzählt Varda in Echtzeit ohne zeitliche Ellipse, nämlich von 17 Uhr bis 18:30 Uhr – das sind eineinhalb Stunden Film für knapp eineinhalb Stunden aus dem Leben der jungen Sängerin. Wo im klassischen Erzählkino all jene für die narrative Weiterentwicklung der Handlung irrelevant erscheinenden Momente weggeschnitten werden, arbeitet Varda gezielt mit dieser Leere und so entwickelt sich der Film zu einem Drama, das es nunmehr wagt, sich nicht mehr über die Handlung, sondern über die Nicht-Handlung (also über das Herumirren, das Warten und die Dauer) auszudrücken. Die Protagonistin lernt in diesen »leeren Momenten« zu sehen, zu nehmen und zu geben, was wiederum zu einer Art Wiedergeburt als selbstbestimmte Figur führt. Auf ihren Spaziergängen durch Paris begegnet sie am Ende ihres Weges dem Anderen in der Figur eines Soldaten aus dem Algerienkrieg sowie ihrem mit der Krankheit konfrontierten Selbst in einer Art abschließenden Erlösung. »Ich bin glücklich« ist ihr letzter Satz im Film.
Bereits in diesem frühen Film der Regisseurin wendet sie sich relevanten feministischen Themen zu, denn Varda dekonstruiert hier die von Cléo anfangs geäußerte Überzeugung: »Solange ich schön bin, ist alles gut«. Die Sängerin wird immer panischer und sieht in ganz Paris Omen für ihren Verfall und Tod. Im Laufe des Films wird ihre Schönheit als Käfig entlarvt, der nicht »alles gut« macht, sondern sie am echten Erleben und Genießen des Lebens hindert, zumindest wenn sie eine derartige Wichtigkeit einnimmt. Das zeigt sich sowohl durch ihre eigenen Erfahrungen als auch durch die Bilder, die Varda entwirft: das Fetischisieren von Kleidung und Spiegeln, Cléo als Puppe, die von ihrer Begleiterin nicht ganz für voll genommen wird und an- und ausgezogen wird, und für die ihr Körper nur ein »Spielzeug« oder eine Schaufensterpuppe ist. Ihre Schönheit schützt sie nicht vor Einsamkeit und so erfährt Cléo in den nicht einmal zwei Stunden, die der Film porträtiert, sich als eigenständige, sich selbst befähigende Person neu. Dabei nehmen Männer nur Nebenrollen ein: Wir sehen grandiose Szenen zwischen Freundinnen und lange Shots, in denen Cléo alleine und irgendwann mit sich zufrieden durch die Straßen von Paris spaziert und durch den Park tanzt. Zwar trifft sie später auf einen Mann, der ihr Zärtlichkeit schenkt, welcher aber nur der letzte Auslöser einer Reihe von Prozessen ist, die Cléo sich selbst näherbringen. »Cléo – Mittwoch von 5 bis 7« wird von manchen Kritiker*innen als erster Film der Emanzipation gesehen, welcher die Thematik allerdings nicht kämpferisch und »männerfeindlich« behandelt, sondern elegant, ruhig und klug.
»Black Panthers« (1968)

Agnès Varda lebte in Kalifornien, als die Black Panther Party Schlagzeilen machten, nachdem ihr Anführer und Mitbegründer Huey P. Newton wegen angeblicher Tötung eines Polizisten am 28. Oktober 1967 verhaftet wurde. Der Prozess gegen ihn hielt noch bis 1968 an, was die Regisseurin dazu veranlasste, zwei Dokumentationen über die Demonstrationen in Oakland zu drehen. »Black Panthers« – ihr zweiter Kurzfilm zu der Thematik – war zu der Zeit der einzige Film pro schwarzer Radikalität, der kommerziell in Amerika gezeigt wurde. Er ist eine aufrührerische Reportage, ein Protokoll der Polizeiwillkür in Oakland, wo die Black Panthers ins Leben gerufen wurden und wo die Polizei besonders brutal agiert.
Der Film bietet den Zuschauenden einen tiefen Einblick in die Kultur der Black Panthers und geht detailliert auf die Umstände und Motivationen der Kundgebung ein. Das Ergebnis ist eine nüchterne Darstellung der aktivistischen Absicht der Gruppe, die fast ausschließlich in den Worten einzelner Vertreter*innen wiedergegeben wird. Auch Newton selbst, den Varda im Gefängnis interviewt, kommt zu Wort und beschreibt die Inspiration der kubanischen Revolution durch die marxistisch-leninistische Philosophie der Partei und warum er sich wie ein politischer Gefangener fühlt. »Es wird eine Einheit zwischen den weißen Radikalen und der schwarzen Kolonie hergestellt«, sagt er, und zu diesem Zweck »hat die schwarze Gemeinschaft bereits einen Sieg errungen«. Gleichzeitig prognostiziert er einen Showdown »zwischen dem Establishment und den kolonisierten Schwarzen im Allgemeinen«, eine Aussage, die all die Jahre später immer noch vorrausschauend klingt.
Varda lässt viel Raum für unbekannte schwarze Männer und Frauen, die sich vor dem Gerichtsgebäude des Bezirks Alameda versammelt haben, um ihre Unterstützung zu zeigen und ihre Meinung zu äußern. Dabei sind sie offen und aufrichtig, wenn es darum geht, Gerechtigkeit für Newton zu sehen – und überzeugt, von rassistischen Vorurteilen seitens der Polizei. Zahlreiche Mitglieder der Black Panthers erlauben Reden und Interviews von den überfüllten Demonstrationen und sogar bekannte Charaktere wie Black-Power-Ikonen Stokely Carmichael und Kathleen Cleaver kommen zu Wort, indem sie präzise Erklärungen und politische Forderungen liefern. Varda, als weiße Regisseurin, beweist viel Respekt und Feingefühl in den Interviews und in der Kameraführung.
Vardas Film vermittelt vielleicht kein vollständiges Bild der Kämpfe der Black Panthers, ihrer gewalttätigen Konfrontationen oder der Herausforderungen, die ihr langfristiges Überleben bedrohten. Stattdessen stellt er eher eine Momentaufnahme dar und fängt die Leidenschaft und Motivation der Menge ein.
»Black Panthers« schließt mit dem Satz »Die Geschichte der Black Panthers ist noch nicht vorbei« und aus einer zeitgenössischen Perspektive betrachtet ist die Dokumentation leider immer noch aktuell. Der Film geht über seine Wut und Frustration hinaus, um seinen eigentlichen Zweck zu verdeutlichen.
»Vogelfrei« / »Sans toit ni loi« (1985)

Zum Schluss möchte ich auf Vardas bereits erwähnten erfolgreichsten Spielfilm »Vogelfrei« eingehen, der in Venedig 1985 den »Goldenen Löwen« für den besten Film erhielt.
Die ersten Bilder des Filmes zeigen die Leiche der jungen, mageren und verdreckten Vagabundin Mona, die in einem Ackergraben liegt und augenscheinlich erfroren ist. Per Voice-Over schaltet sich die Regisseurin höchstpersönlich ein und kündigt an, den Weg der jungen Frau rückblickend bis zu ihrem Tod nachzuzeichnen. Ihre Geschichte ergibt sich aus den Erinnerungen ihrer letzten Weggefährt*innen, die von einer Frau erzählen, die auf ihrer Freiheit beharrt und sich weigert, sich der Gesellschaft anzupassen. Niemand – wahrscheinlich nicht einmal sie selbst – weiß, woher sie kommt und wohin sie geht, dennoch bleibt sie im Gedächtnis. Auf ihrer Wanderschaft begegnet sie den unterschiedlichsten Menschen und findet recht angenehmen Anschluss, ist aber letzten Endes doch immer einsam, da langfristige Beziehungen ständig an ihrem unbedingten Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit scheitern.
Im Gegensatz zu dem fast schon pathetischen Titel »Vogelfrei« deutet der Originaltitel Monas Lebensweise eher pessimistisch: »Sans toit ni loi« – »ohne Dach und Gesetz« trifft den kargen Alltag der jungen Frau schon ziemlich genau. Mona leistet sich die Freiheit, sich keiner Ideologie unterordnen zu müssen und entsagt den kapitalistischen Grundfesten unserer Gesellschaft. Sie ist an keinen Ort und an keine Verpflichtungen gebunden. Was sich vielleicht romantisch anhört, entpuppt sich als Leben ohne Halt: Mit dem Verzicht auf geregeltes Einkommen ergibt sie sich vollends der Willkür von Dritten – sie ist auf die Nächstenliebe und das Mitgefühl der Personen um sie herum angewiesen, ist also alles andere als frei und unabhängig. Das führt zu einem steten Abstieg, der auf einem Feld im Nirgendwo endet.
Auch in diesem Film arbeitet Varda mit neorealistischen Mitteln, um die Handlung glaubhaft zu machen: die Dialoge sind teilweise improvisiert, die Nebenrollen werden von Laiendarsteller*innen gespielt und die Szenerie wird von realen Dekors umrahmt. Nichtsdestotrotz fällt es den Zuschauenden schwer, sich mit der Protagonistin zu identifizieren, da sie als verschlossene, unfreundliche und distanzierte Alleingängerin portraitiert wird, deren soziale und gesellschaftliche Hintergründe wir nicht kennen. In vielen Szenen drehen sich die berichtenden Personen ungeschnitten frontal zur Kamera und fangen an, über ihre Begegnungen mit der Vagabundin zu erzählen. Dieses Durchbrechen der vierten Wand hält die Zuschauenden effektiv auf Distanz und verhindert die Emotionalisierung des Geschehens. Sehr ernüchternd ist ebenfalls die Tatsache, dass der Tod der Protagonistin schon von Anfang an im Raum steht und ein dem Ende Entgegenfiebern somit unmöglich ist. Agnès Varda lässt den Zuschauenden somit keine Chance, sich dem Film hinzugeben – sie will, dass man* sich kühl und nüchtern mit ihm auseinandersetzt. Da die reservierte Mona keinerlei Ideologie formuliert, reicht Varda den Freiheitsbegriff ihrer Protagonistin an uns weiter. Sie stirbt an einem »natürlichen Tod«, doch erscheint das Dahinsiechen eines Individuums in einer westlichen Wohlstandsnation nicht vielmehr »unnatürlich«? Der Film mag eine orientierungslose Frau in das Zentrum der Erzählung stellen, doch es geht hier insbesondere um die Anordnung der Dinge um das Motiv herum. Somit handelt »Vogelfrei« nicht nur von einer freiheitsliebenden und ideologielosen Vagabundin, sondern von der Gesellschaft als großes Ganzes.
Für alle Interessenten: Viele Filme der Regisseurin werden gerade auf der Streamingplattform MUBI gezeigt.
Beitragsbild: © Filmfutter